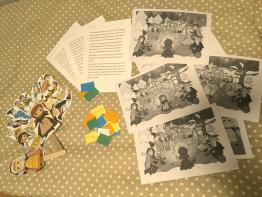Internationale Begegnungen im Klassenzimmer

Der Grundstein für interkulturelle Begegnungen kann bereits im Kindesalter gelegt werden. Ein gutes Beispiel dafür ist das Programm „Europa macht Schule“, das seit Jahren erfolgreich den internationalen Austausch zwischen Studierenden und Schüler:innen fördert.
Adéla Sobotková, eine Lehramtsstudentin aus Tschechien, und Sylvia Stegmüller, Lehrerin an der Grundschule am Napoleonstein, berichten von ihren Erfahrungen – und zeigen, wie bereichernd ein solcher Austausch für alle Beteiligten sein kann.
Zum Programm „Europa macht Schule“
Das vom gleichnamigen Verein Europa macht Schule e.V. initiierte Programm, welches mittlerweile hauptamtlich vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) unterstützt wird, bringt internationale Studierende in deutsche Klassenzimmer. Dort stellen sie auf kreative und persönliche Weise ihr Heimatland vor, sei es durch Geschichten, Tanz, Musik oder Kunst. Ziel ist es, den Schüler:innen einen direkten Zugang zu anderen Kulturen zu ermöglichen, Vorurteile abzubauen und das Gemeinschaftsgefühl in Europa zu stärken. Die teilnehmenden Studierenden profitieren ebenfalls, indem sie das deutsche Schulsystem kennenlernen und ihre eigene Kultur mit einer jungen Zielgruppe teilen können.
Seit 2021 steht das Programm auch Studierenden außerhalb Europas offen, um die Vielfalt der Perspektiven zu erweitern. Organisiert wird es größtenteils ehrenamtlich von Studierenden, die als Standortteams fungieren und Schulen mit passenden internationalen Gästen „verkuppeln“. Teilnehmen können alle Schulformen – von Grundschule über Gymnasium bis hin zur Fachober- und Berufsoberschule. Das Ergebnis: lebendige Begegnungen, die lange nachwirken.
Adélas Besuch in der Grundschule – eine persönliche Reise nach Südmähren
Adéla studiert Lehramt für Deutsch und Tschechisch in Prag und verbringt ein Semester in Regensburg. Über das International Office der Universität erfuhr sie von „Europa macht Schule“ – und meldete sich spontan an.
„Ich fand die Idee sofort spannend, auch wenn ich zuerst dachte, es wäre leichter, mit älteren Schülerinnen und Schülern zu arbeiten“, erzählt sie. Überraschenderweise wurde sie einer dritten Klasse zugeteilt. „Das war für mich neu, aber es hat mir unglaublich viel Freude gemacht.“
In zwei Doppelstunden stellte Adéla der Klasse ihre Heimat Südmähren vor. Am ersten Tag ging es um die tschechische Kultur: Volksfeste, traditionelle Trachten und sogar Musik und Volkstänze. Gemeinsam mit den Kindern malte sie Ornamente aus und sprach über das Leben in ihrer Heimat. Am zweiten Tag tauchte die Klasse in die Welt der tschechischen Märchen ein – ein Highlight für viele Kinder, die bereits den „kleinen Maulwurf“ kannten.
„Die Kinder waren so wissbegierig. Sie wollten nicht nur mehr über die Märchen, sondern auch über den Tornado wissen, der vor drei Jahren mein Dorf getroffen hat.“
Adéla selbst war beeindruckt, wie offen die Kinder waren und wie schnell sie auf sie eingingen:
„Jüngere Kinder zeigen ihre Emotionen sofort – das hilft sehr, den Unterricht anzupassen.“ Auch sprachlich profitierte Adéla, da die Schülerinnen und Schüler sie bei Deutschfehlern unterstützten. „Ich habe gemerkt, wie wichtig solche Projekte sind, um den Respekt für andere Kulturen zu fördern – und ich würde jederzeit wieder mitmachen!“
Perspektive der Lehrerin: Vielfalt als Stärke
Für Sylvia Stegmüller ist „Europa macht Schule“ ein fester Bestandteil ihres Unterrichtalltags. Seit 2015 bringt sie regelmäßig internationale Studierende in ihre Schule und hat durchweg positive Erfahrungen gemacht.
„Wir sind eine sehr bunte Schule mit Kindern aus den unterschiedlichsten Ländern. Dieses Programm passt perfekt zu uns“, erklärt sie.
Die Begegnungen mit den Studierenden inspirieren die Kinder, sich stärker mit ihrer eigenen Kultur auseinanderzusetzen – und sie miteinander zu teilen. So berichtet Sylvia Stegmüller von einem Schüler mit tschechischen Wurzeln, der nach Adélas Besuch von seinen Erfahrungen und Familienbräuchen erzählte.
„Es ist großartig zu sehen, wie die Kinder diese Offenheit übernehmen und sich gegenseitig besser verstehen.“
Auch die Abschlussveranstaltung des Projekts hinterlässt bleibenden Eindruck: Alle beteiligten Schulen und Studierenden kommen zusammen, präsentieren sich und den Eltern ihre Projekte und genießen ein interkulturelles Buffet.
„Für die Kinder ist das ein tolles Erlebnis. Sie sehen, dass ihre Klasse nur eine von vielen ist und dass Menschen aus so vielen Ländern ihre Geschichten mitbringen.“
Kleine Impulse, große Wirkung
Dieses Beispiel zeigt, wie niedrigschwellig Austauschprojekte gestaltet sein können. Ein einfacher Besuch im Klassenzimmer, in dem Geschichten erzählt, Tänze gezeigt oder gemeinsam gebastelt wird, reicht oft aus, um Neugier und Offenheit zu wecken.
Auch Sylvia Stegmüller sieht in „Europa macht Schule“ großes Potenzial für die Zukunft:
„Vielleicht erinnern sich die Kinder später daran und denken: ‚Hey, damals war jemand bei uns in der Klasse – das könnte ich auch mal machen.‘ So tragen wir den Austauschgedanken weiter.“
Gleichzeitig regen solche Projekte auch Lehrkräfte an, neue Wege zu gehen: „Wir waren sensibilisiert und haben gesehen, wie wertvoll es ist, diese Vielfalt zu nutzen.“
Europa wird begreifbar
Das Projekt „Europa macht Schule“ zeigt, dass interkultureller Austausch bereits in jungen Jahren beginnen kann – und sollte. Die persönlichen Begegnungen zwischen den Studierenden und den Schulkindern lassen Europa lebendig werden und helfen dabei, kulturelle Vielfalt als Bereicherung zu begreifen. Adélas Erfahrung und Sylvia Stegmüllers Engagement sind ein inspirierendes Beispiel dafür, wie dieser Austausch gelingen kann und langfristig Brücken baut – zwischen Kulturen, Generationen und Ländern.
Die Gespräche führte Ruth Rothermundt.